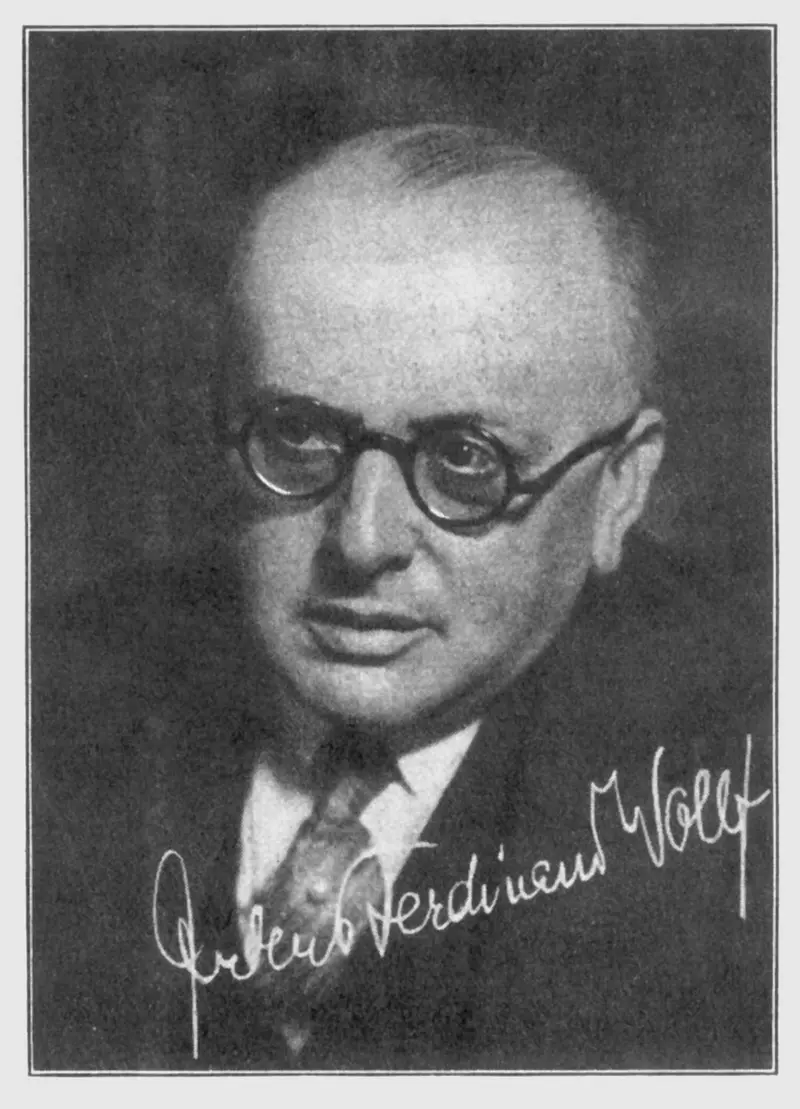Nach Günther Rühle,
Nach Günther Rühle, seit Mitte der 1950er Jahre Journalist, Theaterkritiker und Feuilletonchef verschiedener deutscher Tageszeitungen, waren Wollfs Haus, „in dem Gerhart Hauptmann, Felix Salten, Franz Werfel, S. Fischer, Fritz Busch und viele andere verkehrten, und sein Blatt [Dresdner Neueste Nachrichten] kulturelle Institutionen in Dresden. “Eine enge Beziehung pflegte das Ehepaar Wollf zur Familie des Schriftstellers Felix Salten, der durch seine Tiergeschichte „Bambi. Eine Lebensgeschichte aus dem Walde“ von 1922 weltberühmt wurde. So weilte beispielsweise die Tochter, Anna Katharina Rehmann-Salten, oftmals in den Schulferien im Haus der Wollfs und wurde zur gesetzlichen Erbin vom Nachlass des (kinderlosen) Ehepaares eingesetzt.
Die repräsentative Kunstsammlung der Wollfs beschrieb Emmy Mraczek, eine enge Freundin der Wollfs und Ehefrau des Chefdirigenten der Dresdner Philharmonie detailliert 1956 in einem Gedächtnisprotokoll: „Das Haus von Julius Wollf war wohl mit das wertvollste Haus in Dresden; man kann sagen, dass jedes einzelne Stück einen bedeutenden Wert darstellte. Es waren wohl nur Kunstschätze in diesem Haus.“ Zu den mobilen Werten gehörte eine Sammlung von Ostasiatica, herrliche Uhren, wertvoller Schmuck, Porzellan und Silber sowie Gemälde von Renoir, Kokoschka und wohl Cézanne, eine bedeutende Bibliothek und wertvollstes Inventar. Als die Nationalsozialisten Ende 1938 die „Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens“ erließen – nach der Juwelen, Edelmetalle und Kunstgegenstände bei staatlichen Ankaufstellen abgeliefert werden mussten – seien vom Ehepaar Wolff zwei Möbelwagen voll bedeutender Kunstschätze zwangsweise in das Pfandhaus am Neustädter Markt eingeliefert worden.